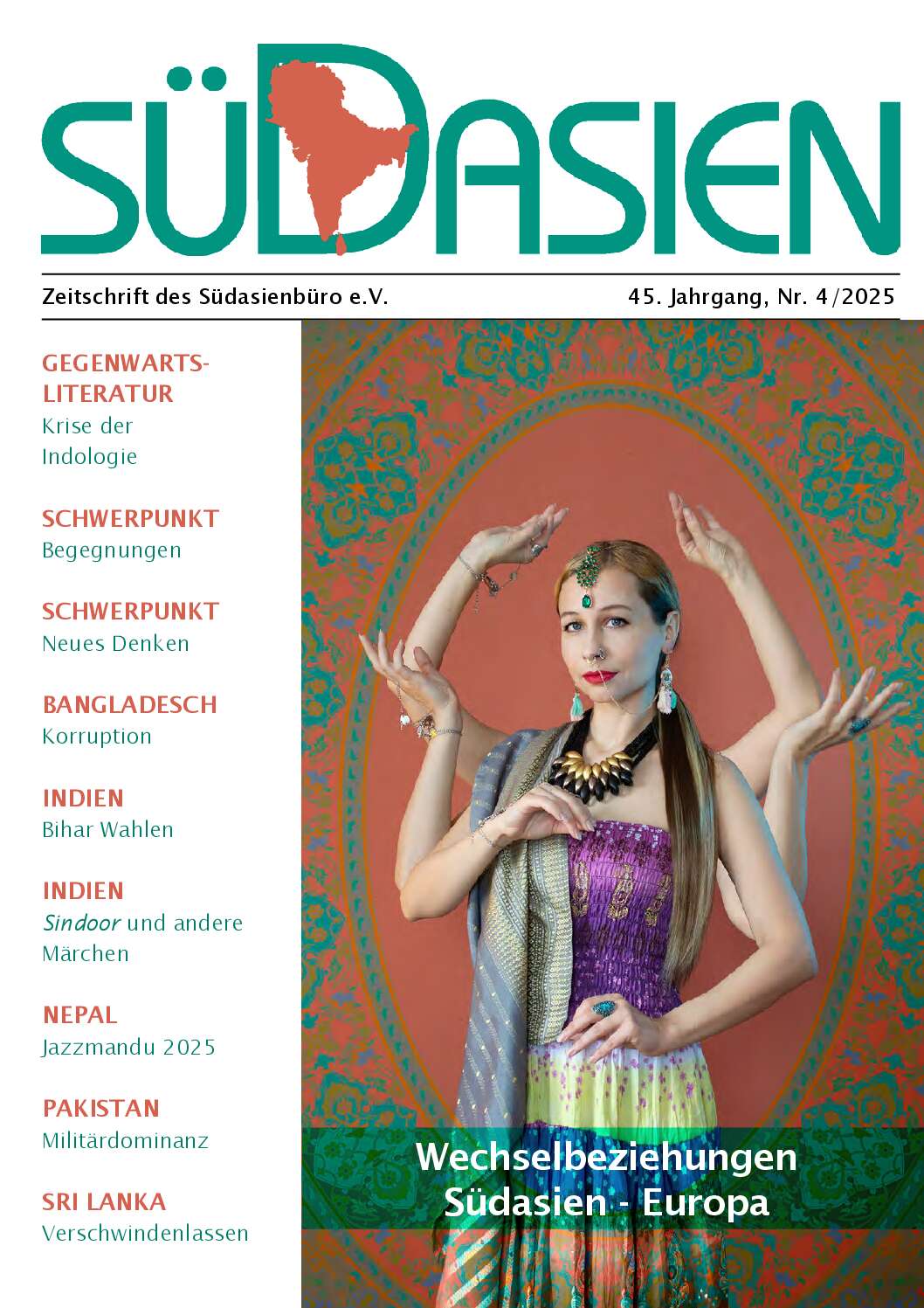Indien hat laut dem achten Zusatz zu seiner Verfassung 22 Nationalsprachen, darunter Hindi und Tamil. Darüber hinaus ist Hindi die „offizielle Sprache“ des Unionsstaates. Vor und auch noch nach der Unabhängigkeit herrschte eine Art Konsens, dass Indien im Zuge seiner nationalen Erweckung eine eigene Nationalsprache benötige und sich vom Englischen als Sprache der politischen und administrativen Kommunikation lösen müsse. Die Sprache der Wahl war der Khadi Boli-Dialekt des Hindi, der sich im Laufe des 19ten Jahrhunderts als Standarddialekt etabliert hatte und seit Jahrhunderten als lingua franca in weiten Gebieten Nordindiens verwendet wurde.
In der indischen Verfassung von 1950 war für diesen Prozess eine Zeitraum von 15 Jahren veranschlagt. Zusätzlich gab die Verfassung in Paragraph 351 den indischen Regierungen den Auftrag, die sprachliche Weiterentwicklung des Hindi zu befördern, und zwar zum einen primär auf der Basis des Sanskrit (in Form von Lehnworten), zum anderen als Spiegel der indischen kulturellen Vielfalt.
In der Tat wurde in den 1950er Jahren in breiter Fläche Hindi als Schulfach in Regionen eingeführt, wo Hindi nicht als Muttersprache gesprochen wird. Gleichzeitig sorgten die modernen Massenmedien für die Verbreitung des Hindi, insbesondere der Bollywood-Film. Doch während sich in der China unter Mao das Mandarin rasch und ohne viel Federlesen über die Minderheitensprachen in der Volksrepublik legten, war das postkoloniale Indien sehr viel vorsichtiger mit seiner Sprachpolitik. Das hing auch damit zusammen, dass die Englisch gebildeten Eliten nicht im Geringsten bereit waren, ihre Sprachprivilegien abzulegen.
Anfang der 1960er Jahre begann sich heftiger Widerstand gegen die Implementierung des Hindi zu regen, und zwar vor allem in Tamil Nadu. Hier ging der Widerstand gegen das Hindi mit dem Dravidismus einher, für den die Sprache ein Vehikel des Versuches des nordindischen Brahmanismus war, den Süden zu beherrschen. Periyar E. V. Ramasamy (1879-1973) und C. N. Annadurai (1909-1979), die beiden großen Führergestalten des (tamilischen) Dravidismus gelang es die tamilischen Massen zu mobilisieren.
Das Ergebnis war – noch zu Lebzeiten von Premierminister Jawaharlal Nehru (1889-1964) – ein Kompromiss, nämlich die sogenannte Drei-Sprachen-Formel: Im indischen Ausbildungssystem sollten auf allen Niveaus drei Sprachen unterrichtet werden, nämlich die jeweilige Landessprache des Bundesstaates, Englisch und Hindi oder eine weitere aus der Liste der Nationalsprachen. Hindi sollte nicht ohne Zustimmung aller Bundesstaaten als Kommunikationssprache des Unionsstaates durchgesetzt werden.
Dem verfassungsmäßig vorgegebenen Ideal einer einzigen indischen Nationalsprache war damit zwar formal Genüge getan. Alle Premierminister haben seitdem die Wichtigkeit der Förderung des Hindi rhetorisch hochgehalten, auch der aus dem heutigen Telangana stammende P. V. Narasimha Rao (Premierminister 1991-1996), dessen Muttersprache das mit dem Tamil verwandte Telugu war, der aber auch vorzüglich Hindi sprach. Ohne Zweifel ist Hindi heute als Zweitsprache viel weiter verbreitet als zur Zeit der Unabhängigkeit. Seit 1975 versuchten indische Regierungen, Hindi auf UN-Niveau als offizielle Sprache durchzusetzen. Narendra Modi, indischer Premierminister seit 2014, verwendet in seinen Reden im In- und Ausland meistens Hindi und nur selten Englisch, dass er nur schlecht beherrscht. In seinem Hindi schlägt gleichzeitig der Akzent seiner Muttersprache Gujarati durch.
Die Drei-Sprachen-Formel ist seit 1968 bis heute der offizielle Referenzrahmen für die Förderung des Hindi und zugleich auch eine sprachpolitische Friedensformel, die von der 2020 verkündeten „Neuen Bildungspolitik“ (New Education Policy, NEP) ausdrücklich bestätigt wird. Während sich faktisch alle Bundesstaaten mit dieser Formel abfanden, hatten die Zentralregierungen stillschweigend und um des lieben Friedens willen geduldet, dass Tamil Nadu die offizielle gesamtindische Sprachpolitik faktisch unterlief. Anfang 2025 zog allerdings das Bildungsministerium in Delhi die Zügel leicht an und drohte damit, bestimmte Zahlungen zurückzuhalten, solange die Drei-Sprachen-Formel in Tamil Nadu nicht voll implementiert sei.
Dies löste im Februar 2025 einen Sturm der Entrüstung im südlichsten Bundesstaat aus. Den Anfang machte Udhayanidhi Stalin, der Sohn des Ministerpräsidenten von Tamil Nadu und Vorsitzender der Jugendorganisation der regierenden Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). Er warnte davor, dass die Tamilen bereit seien, einen weiteren „Sprachkrieg“ zu führen, falls Hindi weiterhin aufgezwungen werde. Stalin betonte, dass die Tamilen „Liebe schätzen, aber sich niemals Drohungen beugen werden“. In den 1960er Jahren kam es in Tamil Nadu zu heftigen Protesten gegen die Einführung von Hindi als einzige Amtssprache, bei denen Demonstranten Züge zerstörten und sich selbst verbrannten.
Ein Vorfall im Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER) in Puducherry hatte schon vor zweieinhalb Jahren zu einem heftigen Wiederaufleben dieses alten Streits geführt. Im April 2022 wurde ein Rundschreiben veröffentlicht, das vorsah, dass alle offiziellen Dokumente in Hindi und Englisch geführt werden sollten, wobei zukünftige Einträge „so weit wie möglich nur in Hindi“ erfolgen sollten. Dies führte zu heftigen Protesten und wurde als Zwangsmaßnahme verurteilt.
Obwohl die NEP nicht explizit vorschreibt, dass Hindi unterrichtet werden muss – stattdessen kann auch eine andere indische Sprache gewählt werden -, befürchten Politiker in Tamil Nadu, dass dies letztlich zur Einführung von Hindi als zweite Sprache neben der Muttersprache führen könnte. Sie argumentieren, dass dies die regionalen Sprachen bedrohe. Rationeller sei eine Zwei-Sprachen-Politik, nämlich die jeweilige Sprache des Bundeslandes und Englisch. Wortführer dieser Forderung ist inzwischen M.K. Stalin, der Ministerpräsident von Tamil Nadu. Er wurde übrigens am 1. März 1953 geboren, also noch zu Lebzeiten Stalins, dessen Namen er erhielt.
Auch in der Lok Sabha, im Parlament in Delhi, fliegen in diesen Tagen die Fetzen. Hier hat sich unter anderem die ehemalige Verteidigungsministerin und derzeitige Ministerin für Finanzen und Unternehmensangelegenheiten Nirmala Sitharaman im Kabinett Narendra Modi für das Hindi stark gemacht. Sie stammt selbst aus Tamil Nadu, vertritt die Regierungspartei BJP – die im Landesparlament auf der Oppositionsbank sitzt – und sieht sich als Vorkämpferin für das Recht tamilischer Kinder auf Hindi-Schulunterricht.
Der Konflikt spiegelt die tieferliegenden Spannungen zwischen der Förderung einer einheitlichen nationalen Identität und dem Erhalt der vielfältigen sprachlichen und kulturellen Identitäten Indiens wider. Es geht auch um die Frage, wieweit das Projekt des Hindi mit dem Projekt der Hinduisierung der indischen Politik verknüpft ist. Dies ist zwar nicht im Sinn der Verfassung, könnte aber faktisch so wirken.
Einstmals war die Sache des Hindi ein Projekt der Entkolonisierung. Mahatma Gandhi war einer der ersten, die von der zukünftigen all-indischen Kommunikation in Hindi geträumt hatten. In seinem frühen Traktat „Hind Swaraj“ von 1909, geschrieben fünf Jahre vor seiner Rückkehr aus Südafrika nach Indien, sah er in der Anglisierung eine Form der Versklavung, von der sich Indien befreien müsste. Er sah darin auch eine Aufgabe – alles was der menschliche Geist in anderen Sprachen an Gutem und Wertvollem hervorgebracht habe, sollte ins Hindi übersetzt und dessen Entwicklung damit befördert werden, forderte Gandhi schon 1909. Gandhi ging es um indische Identität in einer postkolonialen Welt, nicht um das Projekt der Hinduisierung Indiens.
In der gegenwärtigen Debatte scheinen diese Überlegungen seltsam unzeitgemäß. Die Verteidiger des indischen Säkularismus sind oft mehr in der Welt des Englischen zuhause und lassen sich ungern in die Niederungen der Diskurse in indischen Sprachen herab. Zugleich ist der aktuelle Sprachkonflikt ein Mittel des Ministerpräsidenten von Tamil Nadu, sich publikumswirksam in Szene zu setzen – zum einen als Gegner der BJP, zum anderen aber auch als Kämpfer wider die Macht Nordindiens innerhalb der Union und für das Tamilentum.
Heinz Werner Wessler